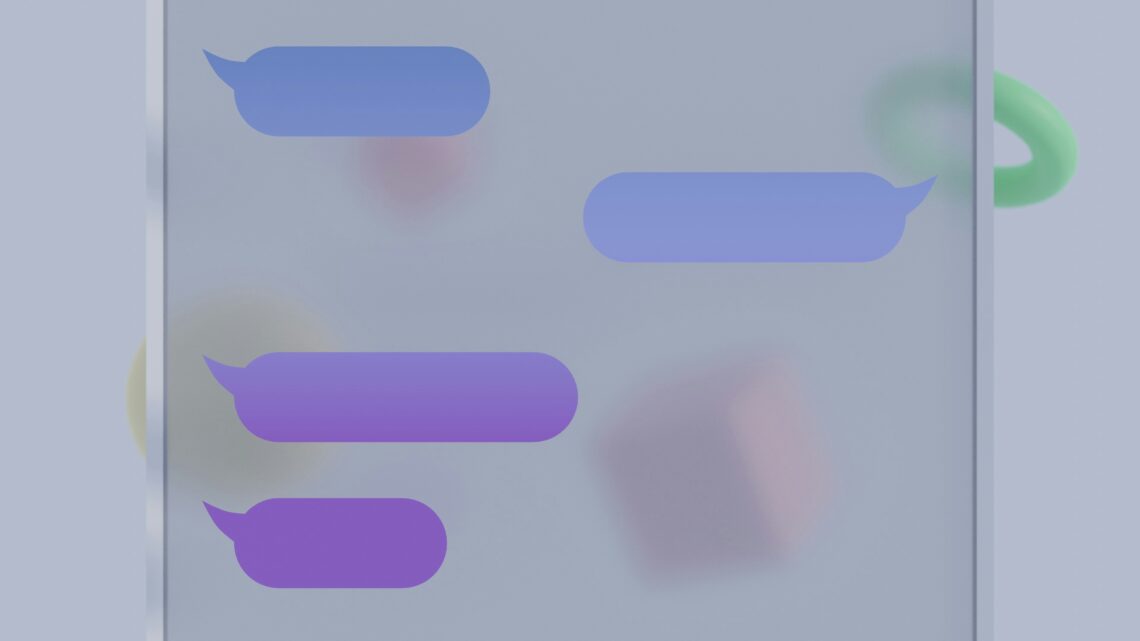
Digitale Gewalt gegen Spitzensportlerinnen
Wenn Erfolg zur Bedrohung wird – und Misogynie den Ton angibt.
Frauen, die gewinnen, sind gefährlich. Zumindest in den Augen eines misogynen Systems. Wer glaubt, dass es beim Online-Hass gegen Spitzensportlerinnen „nur“ um Kritik an Leistung geht, der irrt. Es geht um viel mehr: um ein tief verankertes patriarchales Weltbild, das Frauen in ihrer Selbstbestimmung, Stärke und Sichtbarkeit systematisch kleinhalten will.
Misogynie – nicht Meinung
Die Welle an Hass, die Athletinnen wie Jess Carter (England) oder zahlreiche Biathletinnen und Tennisspielerinnen derzeit erleben, ist kein „Ausreißer“, kein zufälliger Troll-Sturm. Sie ist Ausdruck eines Weltbildes, in dem Frauen nicht stark, nicht sichtbar, nicht erfolgreich, nicht selbstbewusst sein dürfen – vor allem nicht in männlich konnotierten Arenen wie dem Profisport.
Was sich in Kommentaren wie
„Sie ist keine richtige Frau“
„Typisch, wenn Frauen sich überschätzen“
„Zurück in die Küche“
äußert, ist nicht bloß schlechte Kinderstube. Es ist klassische, internalisierte Misogynie.
Wenn Leistung zweitrangig wird
Während Männer im Sport für ihre Fähigkeiten gefeiert werden, wird Frauen die Legitimität überhaupt erst abgesprochen:
Kompetenz wird angezweifelt. („Das ist kein echter Fußball“, „Das Tempo reicht doch nicht“)
Körper werden sexualisiert oder abgewertet. („Zu maskulin“, „Zu sexy“, „Zu hässlich“)
Erfolge werden relativiert. („War ja nur gegen andere Frauen“, „Könnte nie gegen Männer bestehen“)
Diese Angriffe zielen auf mehr als die sportliche Leistung. Sie zielen auf die gesellschaftliche Daseinsberechtigung von Frauen, die Grenzen verschieben.
Warum Frauen besonders betroffen sind
Weil sie sichtbar machen, was lange unsichtbar war: weibliche Stärke, Strategie, Ausdauer, Dominanz.
Weil sie Erwartungen brechen: Wer gelernt hat, dass Frauen sanft, unterstützend und im Hintergrund zu bleiben haben, wird durch eine aggressive Torschützin oder souveräne Kapitänin provoziert.
Weil sie Räume besetzen, die lange Männern gehörten – vom Stadion bis zur Sportredaktion.
Und: Weil sie in einem digitalen Klima agieren, das immer noch nicht neutral, sondern tief patriarchal ist.
„Es geht nicht um dich“ – Doch, tut es.
Die Erfahrung von Jess Carter – rassistisch beleidigt, öffentlich erniedrigt, zur Aufgabe gezwungen – ist kein Einzelfall. Sie steht für eine lange Geschichte von Frauen, deren Erfolge als Provokation empfunden werden. Wenn Frauen sich Raum nehmen, tritt das Weltbild vieler ins Wanken, das sie für selbstverständlich halten: Macht gehört Männern. Stärke ist männlich. Emotion ist Schwäche. Sichtbarkeit ist gefährlich.
Was wir wirklich brauchen
Feministische Medienkompetenz: Wer kommentiert, muss auch verstehen, was Sprache bewirkt.
Gesetzgeberisches Nachziehen: Online-Plattformen müssen verpflichtet werden, Misogynie wie Rassismus zu ahnden – schnell, sichtbar, wirksam.
Konsequentes Framing: Es geht nicht um „beleidigte Frauen“, sondern um systematische Angriffe auf Gleichberechtigung.
Solidarische Öffentlichkeit: Die größten Gegner von Misogynie? Sichtbare Männer und Frauen, die Haltung zeigen. Nicht später – jetzt.
Digitale Gewalt gegen Sportlerinnen ist kein Randphänomen. Sie ist der digitale Ausdruck eines Weltbildes, das Frauen in ihrer Macht beschneiden will.
Aber es ist auch ein Moment der Wahrheit. Denn je stärker der Widerstand, desto klarer wird: Diese Frauen verändern etwas. Sie erschüttern alte Strukturen. Sie schreiben Geschichte. Und wir? Wir entscheiden, ob wir Teil dieser Veränderung sein wollen – oder Teil des Problems bleiben.
Zum weiteren Einlesen in das Thema: Gute Beiträge fand ich dazu auch in der FAZ und der Sportschau.

